sierra: 11.50 — An diesem Freitagmorgen, Nebelschleierwolken lungern über dem Tal der Salzach, konnt ich seit 47 Tagen erstmals mit meiner rechten Hand wieder mein rechtes Ohr berühren. stop. Angedockt. stop. Die Meldung gegen den Mittag zu, Neutrinos auf unterirdischem Wege von Genf nach Rom seien schneller geflogen als das Licht. — stop

Aus der Wörtersammlung: mensch
dair az-zaur
sierra : 7.48 — Das zwanzigste Jahrhundert blickt nieder auf eine geheimnislose Welt. Alle Länder sind erforscht, die fernsten Meere zerpflügt. Landschaften, die vor einem Menschenalter noch selig frei im Namenlosen dämmerten, dienen schon knechtisch Europas Bedarf, bis zu den Quellen des Nils, den Langgesuchten, streben die Dampfer; die Viktoriafälle, erst vor einem halben Jahrhundert vom ersten Europäer erschaut, mahlen gehorsam elektrische Kraft, die letzte Wildnis, die Wälder des Amazonasstromes ist gelichtet, der Gürtel des einzig jungfräulichen Landes, Tibets, gesprengt. Das Wort TERRA INCOGNITA der alten Landkarten und Weltkugeln ist von wissenden Händen überzeichnet. – Stefan Zweig. In jenen Landschaften aber Frauen, Männer, Kinder. Ahnungen. Was in der ostsyrischen Stadt Dair az-Zaur protestierenden Menschen in diesen Stunden geschieht, wissen wir nicht. – stop

salzburg : stefan zweig, kapuzinerberg no 5
lima : 8.16 — Von der Linzer Gasse hinauf zum Paschingerschlössel, in dem Stefan Zweig mit seiner ersten Frau, der Schriftstellerin Friederike Maria Burger, 15 Jahre lang wohnte und arbeitete. Ein steiler Weg, 264 Treppenstufen, James Joyce und Thomas Mann werden diese Strecke gegangen sein vor einer Sekunde noch vor den langsam westwärts fließenden Bergen. Das Haus No 5, großzügige Terrasse, hinter Laubbäumen versteckt, scheint sich von selbst im leichten Wind zu bewegen. Unten im Tal, schneegrün an diesem Abend, die Salzach. Auf den Dächern der Stadt lungern moderne Menschen, sie lesen, trinken Wein, schlafen in ihren Himmelsgärten in der warmen Novembersonne. Ein später Feuerkäfer passiert den schmalen, steinigen Weg, längst bin ich im Wald angekommen. Das Kloster der Kapuzinermönche liegt hinter mir. Buchen, Eschen, Linden brennen. Eine gebückt gehende alte Frau, ich sehe, sie geht kreuz und quer über die Pfade des Berges. So betagt muss sie ihrer Erscheinung nach sein, dass sie Stefan Zweig noch persönlich gekannt haben könnte. Wie sie zuletzt unter den Bäumen verschwindet, uraltes Kind, dachte ich an eine Fotografie, die in der digitalen Sphäre existiert. Sie zeigt Stefan Zweig und seine zweite Frau Lotte Altmann in ihrem Haus in der brasilianischen Stadt Petrópolis leblos liegend auf einem Bett. Dieser Blick nun eines Journalisten und seiner Lichtfangmaschine, der seit dem 23. Februar 1942 nicht wieder zurückgeholt werden kann. — stop

PRÄPARIERSAAL : cerebum
![]()
nordpol : 8.02 — TONAUFNAHME / Mai 2005 — Yomo : Als wir das Gehirn entnahmen, haben wir uns zunächst keine Gedanken darüber gemacht, was für ein faszinierendes Teil des menschlichen Körpers wir gerade in der Hand hielten. Wir hatten das nämlich so verstanden, dass die Studierenden das Gehirn selbst entnehmen dürfen und wir haben das dann auch gemacht. Aber bald haben wir festgestellt, dass die Assistenten, nicht die Studierenden, das an den anderen Tischen machten. Wir hatten bei der Entnahme einen Fehler gemacht und das Gehirn an der falschen Stelle durchtrennt. Wir waren sofort damit beschäftigt, zu überlegen, was wir jetzt machen sollen, um keinen Ärger zu bekommen. Wir haben deshalb in dieser Situation nicht so sehr an das Gehirn gedacht. Zum Glück kam dann aber eine nette Assistentin und hat das Gehirn vollständig entnommen, ohne uns weiter Vorwürfe zu machen. Sie fand unsere Art der Entnahme fast noch besser als die vorgegebene Methode, da man viele Strukturen sehen konnte, die wir anders nicht gesehen hätten. Wir waren auf jeden Fall ziemlich froh, dass wir keinen Ärger bekommen haben. Ich habe erst etwas später ein besonderes Gefühl gespürt, als ich das Gehirn in den Händen hatte. Vielleicht lag das auch daran, dass wir uns am Anfang auch noch gar nicht so genau mit dem Gehirn auskannten. Ein paar Dinge über das Gehirn wusste ich zwar schon aus der Schule, aber wie genau es aufgebaut ist, aus wie vielen Strukturen das Gehirn besteht und was man alles an einem Gehirn sehen kann, das habe ich erst in der Anatomie gelernt. So wurde das Gehirn im Lauf Zeit zu einem immer interessanteren und faszinierenderen Körperteil für mich. An dem Tag, als wir die Sulci mit bunten Fäden auslegen sollten, hatte ich das Gehirn dann länger in der Hand. Das ist jener Tag, an den ich mich besonders intensiv erinnern kann, da ich ein besonderes Gefühl hatte, als ich das Gehirn in der Hand gehalten habe. Ich war ein wenig glücklich und stolz auch, denn wer hat schon die Möglichkeit ein Gehirn in der Hand zu halten. Für mich war kaum vorstellbar, dass diese Struktur in meiner Hand einmal so viele und wichtige Aufgaben erfüllt hatte.
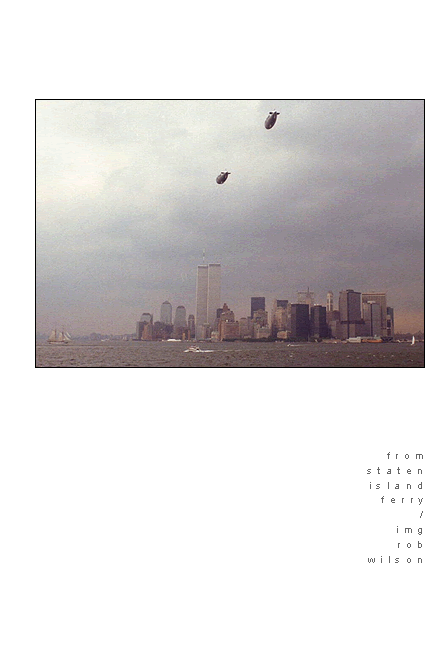
fasankino
tango : 0.02 — Gestern, Dienstag, ist Ilse Aichinger 90 Jahre alt geworden. Ich erinnerte mich an einen Text, den ich vor einiger Zeit bereits aufgeschrieben habe. Der Text scheint noch immer nah zu sein, weshalb ich ihn an dieser Stelle wiederholen möchte. Ich betrachtete damals, als ich den Text notierte, eine Filmdokumentation. Es war ein früher Morgen und ich fuhr in einem Zug. Immer wieder spulte ich, Zeichen für Zeichen vermerkend, was ich hörte, den Film zurück, um kein Wort des gesprochenen Textes zu verlieren oder zu verdrehen. Und so kam es, dass auch Ilse Aichinger, von einem unruhigen Geleise geschüttelt, immer wieder auf dem handtellergroßen Bildschirm unter spazierenden Menschen vor mir auftauchte, indem sie von ihrer Kinoleidenschaft erzählte: Wenn ich mich recht erinnere, hörte ich in meiner frühen Kindheit eine ältere Frau zu einer anderen sagen: – Es soll jetzt Tonfilme geben. – Das war ein rätselhafter Satz. Und es war einer von den ganz wenigen rätselhaften Sätzen der Erwachsenen, die mich nicht losließen. Einige Jahre später, ich ging schon zur Schule, sagte die jüngste Schwester meiner Mutter, wenn wir an den Sonntagen zu meiner Großmutter gingen, bei der sie lebte, fast regelmäßig am späten Nachmittag: > Ich glaube, ich gehe jetzt ins Kino. < Sie war Pianistin, unterrichtete für kurze Zeit an der Musikakademie in Wien und übte lang und leidenschaftlich, aber sie unterbrach alles, um in ihr Kino zu gehen. Ihr Kino war das Fasankino. Es war fast immer das Fasankino, in das sie ging. Sie kam fröstelnd nach Hause und erklärte meistens, es hätte gezogen und man könne sich den Tod holen. Aber sie ließ ihr Fasankino nicht, und sie holte sich dort nicht den Tod. Den holte sie sich, und der holte sie gemeinsam mit meiner Großmutter im Vernichtungslager Minsk, in das sie deportiert wurden. Es wäre besser gewesen, sie hätte ihn sich im Fasankino geholt, denn sie liebte es. Aber man hat keine Wahl, was ich nicht nur bezüglich des Todes, sondern auch bezüglich der Auswahl der Filme zuweilen bedauere, wenn meine liebsten Filme plötzlich aus den Kinoprogrammen verschwinden. Obwohl ich es gerne wäre, bin ich leider keine Cineastin, sondern gehe sechs oder siebenmal in denselben Film, wenn in diesem Film Schnee fällt oder wenn die Landschaften von England oder Neuengland auftauchen oder die von Frankreich, denen ich fast ebenso zugeneigt bin. Ilse Aichinger: Mitschrift

zeitort


![]()
lima : 7.22 — Seltsam ist an Buchstaben, dass man ihnen die Zeit nicht ansehen kann, die in ihnen steckt. Diese achtzehn Wörter und alle weiteren Wörter an dieser Stelle habe ich bereits an einem sehr viel früheren Montagabend notiert. Es ist jetzt 7 Uhr und 15 Minuten und ich bin fern meinem Schreibtisch und weiß doch, dass mein Satz sichtbar werden wird für andere Menschen in genau dieser Minute, freigelassen sozusagen, ohne in diesem Moment auch nur einen Finger bewegt zu haben. Denkbar, dass ich gerade unter einem Regenschirm spaziere. Vielleicht schlafe ich noch oder vielleicht bin ich längst über den Atlantik geflogen und habe noch keine Verbindung in öffentliche Funkräume gefunden. — stop

PRÄPARIERSAAL : periskop
echo : 8.15 — Zur Winterzeit mit einer jungen Frau, einer Malerin, in einem botanischen Garten spaziert. Sie erzählte von ersten Beobachtungen im Präpariersaal. Ihre leise Stimme, tief, die helle Wölkchen in der eiskalten Luft erzeugte. Und ein Blick, wenn sie mich ansah, der wie durch ein Sehrohr zu kommen schien. Auf dem Dach eines Glasschauhauses balancierte ein Mann mit einer Schaufel. Schwäne klapperten Schnäbel durch kniehohen Schnee. Entdeckte eine Notiz, die sie mir wenige Wochen später übermittelt hatte, weil ihr Kopf nach unserem Spaziergang weiterhin anatomische Sätze erzeugte. Ein Ausschnitt. Sophie schreibt: > Was ich sah, war Chaos. Merkwürdigste, fremdartige Formen auf Tischen, die von Studierenden bewegt wurden. Es war abstoßend und ängstigend. Ich dachte daran, dass dies einmal Menschen gewesen waren. Dann aber wurden in meinen Gedanken aus jenen gewesenen Menschen Körper, und es wurde möglich, das, was ich sah, mit Begriffen zu versehen. Ganz mechanisch sagte ich Bezeichnungen für Körperteile, die ich identifizieren konnte, vor mich hin. Ich glaube, dass sich in diesem Moment meine Emotionalität von meinem Intellekt trennte und sich irgendwo – sicher vor weiteren Eindrücken – versteckte. Und ich war erleichtert, zu sehen, dass das Geheimnis des Todes ein Geheimnis geblieben war. Ich beobachtete mit Verstand. Trotzdem sah ich tief aus mir selbst heraus. Ich wanderte zwischen Leichen umher, die von weißen Kitteln umringt waren, wie in einer Blase, die mich schützte, und doch war ich sehr zerbrechlich. In der Mitte der Körper, dort wo normalerweise der Bauch ist, war jeweils ein Loch zu sehen. Neugierig geworden, musste ich näher an die toten Körper herantreten. Ich sah das viele Fleisch, gelbe fettige Farbe unter farbloser Haut. Ich war überhaupt überrascht von der Farblosigkeit der Körper und stellte fest, wie wenig Menschliches, wie wenig Persönliches noch an ihnen zu erkennen gewesen war. Obwohl ich diesen Ort besuchte, um zu zeichnen, hatte ich bei meinen ersten Besuchen weder Papier noch Bleistift dabei. Ich wollte zunächst nur sehen. — stop

lichtbilder
![]()
marimba : 2.15 — Existieren in diesem Moment noch Menschen, die während ihres Lebens nie auf einer Fotografie abgebildet sein werden? — stop

amsterdam
lichtinseln
foxtrott : 6.15 — Ich kann vielleicht sagen, dass ich, sobald sich die Augen eines Schlafenden vor meinen eigenen Augen öffnen, ohne Ausnahme sofort gefangen bin. Habe in der Beobachtung schlafender Menschen nachts, wenn ich durch Flughafenhallen spazierte oder in Subwayzügen reiste, Erfahrungen gesammelt, der Blick auf vorüberziehende Lichtinseln draußen vor dem Fenster, dann wieder auf das entspannte Gesicht eines unbekannten Reisenden, der träumte. So schnell sich die Augen eines Schlafenden öffnen, kann ich meinen beobachtenden Blick niemals verbergen. Vermutlich existiert keine schnellere Bewegung, zu der ein menschlicher Körper in der Lage wäre, als jene Bewegung der Augen, wenn sie sich öffnen. Erstaunlich ist darüber hinaus, dass diese in Bruchteilen einer Sekunde entkleideten Augen unverzüglich präsent sind, weil der Blick sogleich anwesend ist und wirkungsvoll, sein Licht, vielleicht deshalb, weil ein Blick noch vor der Öffnung der Augenlider beginnt oder zu Lebzeiten niemals endet. — stop
![]()


