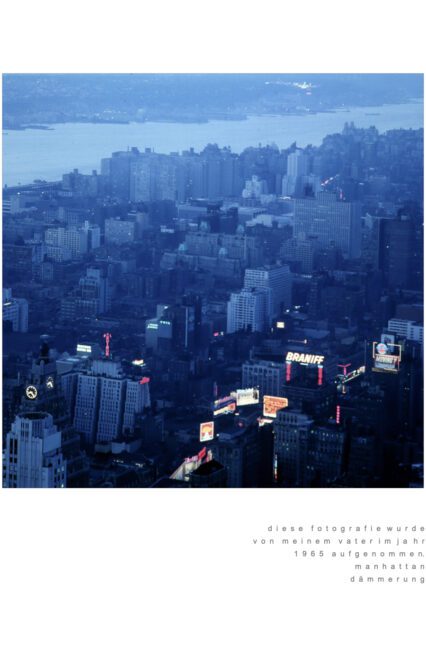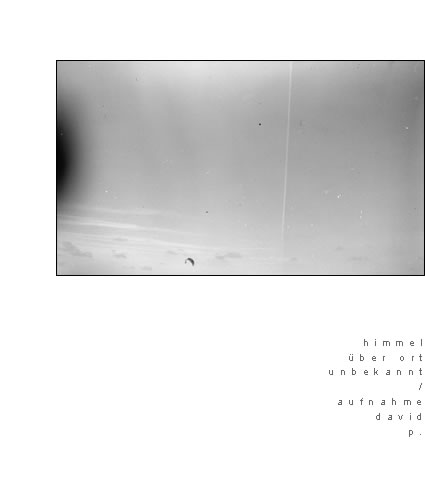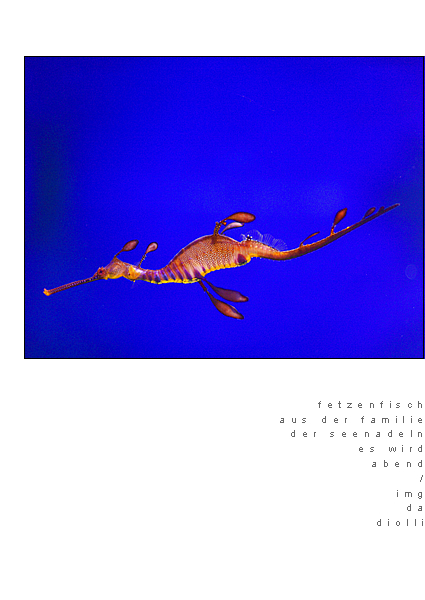zoulou : 15.18 UTC — Winter. Landschaft tief verschneit. Ich erinnere Vater, wie er auf den Balkon unseres Hauses ein Kamerastativ stellt. Der Fotoapparat, den er auf das Stativ schraubte, richtete seine Augenlinse zum Garten hin, auf eine unberührte Decke von Schnee über einem Teich, der sich kaum wahrnehmbar durch eine leichte Vertiefung abzeichnete unter dem glitzernden, kalten Tuch. Von dem Fotoapparat aus führte ein feines Kabel in Vaters Arbeitszimmer. Das Kabel war mit seinem Computer verbunden, der dem Fotoapparat jede halbe Stunde einmal Anweisung gab, eine Aufnahme des Gartens anzufertigen. Viele Jahre später entdeckte ich eine Serie dieser Aufnahmen. Spuren sind dort zu erkennen einer Katze, die selbst nicht zu sehen ist. Der Kopf einer Amsel weiterhin, die nach ihrer Landung im Schnee versunken zu sein schien. Kurz darauf eine weitere Katze, die der Spur jener unsichtbaren, früheren Katze folgt. Auch Mutter hat ihren Auftritt. Ihr Kopf ist zu erkennen, und ihre Hände, die in den Bildausschnitt ragen. Sie wirft Nüsse in den Schnee. Eine weitere Aufnahme, es ist vielleicht später Nachmittag, zeigt Vater inmitten seines Gartens. Er schaut hoch zur Kamera. — stop