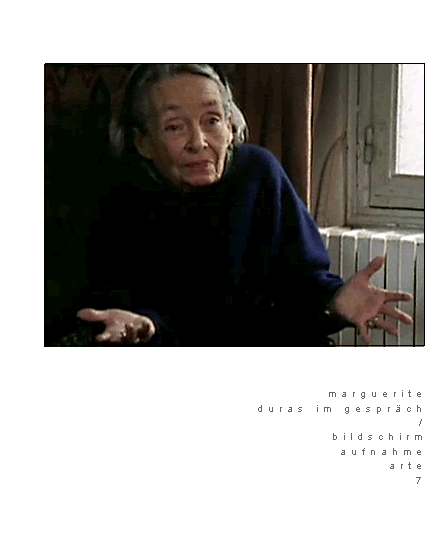himalaya : 0.02 — Vielleicht darf ich folgenden Bericht in voller Länge wiedergeben. Der junge Journalist Zouhir al Shimle berichtet via E‑Mail für Die Zeit: Seit Aleppo belagert ist, fliegen Assads Truppen und seine Verbündeten jeden Tag Luftschläge auf die Viertel der Rebellen, also auch dort, wo ich lebe. Ununterbrochen dröhnen Kampfjets über uns hinweg, Helikopter kreisen über den Häusern. Jeden Tag sterben hier fast fünfzig Zivilisten. Wir leben in einem nie endenden Getöse von Schießereien, Explosionen, Geschrei. Die meisten von uns trauen sich nicht mehr, nach draußen zu gehen. Manchmal hetzen ein paar Leute die Straßen entlang, um Lebensmittel zu besorgen – und rennen sofort nach dem Einkauf zurück in ihre Wohnungen. Dabei ist es zu Hause nicht sicherer als auf der Straße. Denn die Bomben treffen auch unsere Häuser. Während ich diese Zeilen schreibe, höre ich das Donnern der Kampfflugzeuge, von irgendwo her dringt Gefechtslärm. Gott sei Dank habe ich bisher alle Angriffe überlebt. Aber vor ein paar Tagen war ich dem Tod so nah wie nie zuvor. Ich war im Viertel Al-Mashhad unterwegs, dort, wo mein Büro ist. Ich stand gerade im Laden in unserer Straße, um mir etwas zu trinken zu kaufen, als die erste Fassbombe einschlug, gerade mal fünf Häuser von uns entfernt. Ich duckte mich für einige Sekunden vor den umherfliegenden Metallteilen. Dann rannte ich raus auf die Straße. Nur wenige Sekunden später schlug in der Straße die zweite Fassbombe ein. Ein Metallsplitter bohrte sich in meinen Rücken, ein anderer in mein Bein. Ich rannte von der Straße wieder zurück zum Laden. Und war vor Schock wie gelähmt: Sieben Menschen, die dort Schutz vor der zweiten Bombe gesucht hatten, waren tot, zerquetscht vom Schutt der eingestürzten Decke. Sie starben nur, weil sie sich in den Sekunden der Explosion anders entschieden hatten: Sie hielten sich zwischen den Regalen versteckt, während ich auf die Straße lief. Nur deswegen habe ich als Einziger von uns überlebt. Die Helfer hatten große Mühe, die verdrehten und durchtrennten Körper aus dem Geröll zu ziehen. Angehörige der Toten lagen am Boden und schrien, Kinder weinten. Aus einigen Körpern quollen Innereien, überall lagen abgetrennte Hände und Beine. Insgesamt starben durch diese Angriffe 15 Menschen, 25 – mit mir – wurden verletzt. Ich kann diese Bilder nicht vergessen. Ich hätte einer dieser Körper sein können. Ich wurde schnell in ein Krankenhaus gebracht, doch helfen konnte mir dort niemand. Zu viele Menschen benötigten Hilfe, unaufhörlich brachten Männer neue Tragen mit Schwerverletzten hinein. Während ich auf den Arzt wartete, sah ich so viel Blut, dass ich zu halluzinieren begann. Ein Freund brachte mich deshalb in ein anderes Krankenhaus, wo sich Schwestern um mich kümmerten. Sie entfernten einen Metallsplitter, der andere steckt noch in meinem Bein. Sie sagen, er könne erst in einiger Zeit entfernt werden. Doch es sind nicht nur die Bomben und Gefechte, die unser Überleben immer schwerer machen. Das Regime hat nun auch die Castello-Straße eingenommen. Sie ist eine Todeszone geworden: Ständig wird geschossen, brennende Autos liegen am Straßenrand. Das Regime kämpft dort mit aller Macht – und schneidet uns damit von der Außenwelt ab. Die Castello-Straße war bislang die einzige Verbindung von Aleppo nach draußen, in die Vororte und in die Türkei. Es war die Lebensader der Stadt, von dort haben wir Lebensmittel, Gas, Brennstoff, Trinkwasser und Medizin bekommen. Die Belagerung ist für uns dramatisch. Denn jetzt gibt es kaum noch Obst und Gemüse zu kaufen, überhaupt sind die Märkte fast leer. Auch haben wir immer weniger Brennstoff, wir verbrauchen gerade die letzten Reserven der Stadt. Bald schon werden wir in kompletter Dunkelheit leben. Das ist es, was das Regime und seine Milizen wollen: dass Aleppo langsam stirbt. Sie setzen dabei allein auf die Zeit. Wir, die noch rund 300.000 Verbliebenen, werden nicht mehr lange versorgt werden können. Ich fürchte, dass unser Untergang schließlich dadurch kommt, dass wir alle um Wasser und Brot kämpfen. Und dass die, die nicht mehr stark genug sind, darum zu kämpfen, einfach verhungern werden. Fakt ist: Wir sitzen fest. Wir haben keine Chance mehr, aus Ost-Aleppo herauszukommen. Ich habe immer mit drei Freunden in einer WG zusammen gewohnt. Jetzt ist nur noch einer von ihnen hier. Malek hat geheiratet und lebt nun mit seiner Frau zusammen, sie erwarten ein Baby. Der andere, Jawad, konnte in die Türkei entkommen. Sein Vater wurde bei einem Angriff schwer verletzt und Jawad konnte mit ihm vor ein paar Wochen in die Türkei fahren, damit er dort medizinische Hilfe bekommt. Jawad versucht, wieder zu studieren. Er wird nicht mehr nach Aleppo zurückkommen. So zynisch es klingt: Er hat Glück gehabt. Denn nur sehr kranke Menschen dürfen mit einer Begleitung den Grenzübergang Bab al-Salameh in die Türkei passieren. Die Türkei ist da sehr strikt. Für mich gilt das also nicht Selbst, wenn ich Aleppo verlassen wollte: Ich kann es nicht. Die Bombardierungen in der Stadt sind zu stark, ich würde nicht mehr weit kommen. Ich weiß, dass ich hier nicht mehr wegkommen werde. Die Bomben fallen weiter, jeden Tag, jede Stunde. Sie treffen alles, was sich bewegt. Ich sitze in Aleppo fest. Aber noch bin ich am Leben. — stop

![]()