marimba : 3.58 — In einem Moment der Stille beobachtete ich vor wenigen Stunden ein Bücherregal, das in meinem Arbeitszimmer steht. Ich meinte, ein Geräusch wahrgenommen zu haben, in etwa hörte sich das so an, als würde man ein Ohr an ein Bambusrohr legen, durch welches Kieselsteine fallen. Zunächst meldete sich das Geräusch links oben unter der Decke, wo sich Bücher befinden, die ich nicht gelesen habe, wartende Bücher, sagen wir, Mahnende. Kurz darauf wanderte das Geräusch in die Mitte des Regals, Christoph Ransmayr klimperte, John Berger, Janet Frame, Antonio Tabucchi. Ich hatte für einige Minuten den Eindruck, das Geräusch oder seine Ursache könnte sich vervielfältigt haben. Wenn nun folgendes geschehen wäre, dass sich die Bücher meines Regals in Funkbücher verwandelten, in Bücher, die nur vorgeben, Bücher von Papier zu sein, in Bücher also, die über Seiten verfügen, die eigentlich Bildschirme sind, die man umblättern kann. Dann wäre denkbar, dass ich jenes typische Geräusch vernommen habe, das in genau dem Moment entsteht, da der Autor eines Buches mittels Funkwellen eine erneuerte Fassung seines Werkes in die Zimmer der Welt entsendet. Ich muss darüber nachdenken, was die Möglichkeit oder die Existenz der Funkbücher bedeuten würde für das Schreiben, für das Aufhören können, für Anfang und Ende einer Geschichte. Und wenn nun Jean Pauls Komet in meinem Zimmer rascheln würde, oder Dantons Tod, Georg Büchner? – Noch zu tun: Regenwörter erfinden. — stop

Aus der Wörtersammlung: existenz
im zimmer. mitternacht
olimambo : 0.15 — Auf der Suche nach Daniil Charms Textsammlung Fälle balanciere ich vor dem Bücherregal auf einem Stuhl. Noch ist Samstag. Ich erhoffe mir in dem gesuchten Buch einen Ort zu finden, dessen Existenz ich fortan beweisen könnte. Ich stehe mitten im Zimmer. Woran denke ich? Ein bemerkenswerter Satz. Wie ich von meinem Stuhl steige und wieder auf dem Boden stehe, halte ich den Kriminalfall Der verschwundene Kopf des Damasceno Monteiro in Händen. Das Buch wurde im Jahre 2000 gekauft und neun Jahre später mit einer Widmung versehen. Der Lieben P. und dem lieben J. zur Erinnerung an ihre Lissabonreise, anlässlich eines Blitzbesuches. Von ihrer G. Nun fällt mir auf, dass G. und J. gestorben sind, während P. und ich, der ich das Buch ausgeliehen habe, noch leben. Auch Daniil Charms ist tot und sein Übersetzer Peter Urban seit wenigen Wochen. Ein trauriger Moment. In meinem Kühlschrank herrschen 7 °C. Ich werde mich gleich auf die Suche nach meinen fünf Marienkäfern machen, die im Kühlschrank in einer Schachtel überwintern sollen. Zwei habe ich bereits entdeckt, das war vor drei Stunden gewesen, vermutlich ist das so, dass ich in dieser Minute alle Käfer aus den Augen verloren habe. Aber ich kann immerhin sagen, dass ich die Käfer gesehen, sie mir also gestern nicht eingebildet hatte. Käfer No 1 saß in der Diele nahe der Tür, als würde er warten. Käfer No 2 bewegte sich im Arbeitszimmer über das Fenster, hinter dem es stockdunkel gewesen war. Bevor ich mich auf die Suche mache, sollte ich vielleicht doch noch einmal einen Versuch unternehmen, meinen Daniil Charms zu finden. Gleich vorsichtig, nur nicht stürzen, den Stuhl besteigen. Bisweilen träumte ich, von einem Berg zu fallen. Langsam, ich gehe durchs Zimmer. Und während ich so gehe, erinnere ich mich lebhaft an G., an unseren letzten gemeinsamen Spaziergang über den Münchener Südfriedhof, wie ich mich wunderte, dass sie genau diesen Weg genommen hatte, um mich zur U‑Bahn zu bringen, da sie ahnte oder wusste, dass sie bald sterben würde. Es war ein warmer Sommerabend. Sie ging von Schmerzen gebeugt. In der windlosen Luft tanzten Fliegentürme. Ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Aber an ihre Stimme, an ihren Blick, ihren letzten Blick, der ein Abschied war. — stop
![]()
sekundenfliege
nordpol : 1.32 — In der vergangenen Nacht habe ich eine E‑Mail notiert. Es war kurz nach drei Uhr. Die Frau, an die ich schrieb, lag vermutlich in einem Bett und schlief. Dass ich an Menschen schreibe, die in dem Moment, da ich notiere, schlafen, ist für mich nicht ungewöhnlich, weil ich immerhin wache, während alle anderen in meiner europäischen Umgebung schlafen. Gestern aber hatte ich ein seltsames Gefühl. Ich meinte, mit der schlafenden Frau unmittelbar sprechen zu können, in dem ich notierte. Ich wusste, dass sie bald aufstehen würde, weil sie gegen 4 Uhr einer wichtigen Aufgabe nachzugehen hatte. Ich notierte: Liebe H., es ist kurz nach drei Uhr. Leider musst Du bald aufstehen. Aber das weißt Du vermutlich gerade noch nicht. – In diesem Moment hörte ich auf zu schreiben, ich war mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht gerade Unsinn notierte. Plötzlich die Frage, ob man davon sprechen kann, dass man im Schlaf etwas weiß, obwohl man gerade daran nicht denken kann, weil man von etwas Anderem träumt? Ich dachte: Lieber Louis, aber natürlich weißt Du, dass in Deiner Küche Scheiben einer Entenbrust darauf warten, verzehrt zu werden. Du weißt das genau seit zwei Stunden, obwohl Du Dich seither in Gilles Leroys Roman Zola Jackson vertieftest. Ja, so dachte ich. Auch erinnerte ich mich an eine Winterfliege, die seit gestern Morgen durch meine Wohnung brummt. Vor drei Minuten habe ich von ihrer Existenz scheinbar nichts gewusst, weil ich mich nicht erinnerte, als wäre sie niemals anwesend gewesen. Irgendetwas ist seltsam hier. — stop
![]()
sturmvögel
ulysses : 0.01 — Mein Vater erzählte, wenn man ernsthaft an etwas arbeite, würde man auch nachts damit beschäftigt sein. Einmal sei an einem riesigen, schnellen Computer im Kernforschungszentrum CERN bei Genf, der mittels tausender Kabelverbindungen an weitere Computer geknüpft gewesen war, ein Kabel versehentlich oder mit Vorsatz aus seinem Stecker gezogen worden. Tagelang seien sie damals auf Knien unterwegs gewesen, um das lose Kabel aufzuspüren, dessen sorglose Existenz ohne Angabe des Ortes auf einem Bildschirm angezeigt wurde. Er habe, sagte Vater, damals die Welt in gelben Farben gesehen und von Kornwaren geträumt. Ich erinnerte mich heute daran, jetzt weiß ich Bescheid und bin zufrieden. Träume seit Tagen von Wirbelstürmen und von kleinen Vögeln, die durch diese Stürme irren. — stop
![]()
batavia
ginkgo : 22.16 — Ich bin nahe daran, mich an die Existenz der Schnecke Esmeralda zu gewöhnen, die am 20. Oktober in der Gestalt eines Geschenks zu mir gekommen war. Es ist so, dass ich nun behutsam durch meine Wohnung laufe, auch niemals im Dunkeln, Esmeralda könnte vielleicht gerade über den Boden wandern. Alle Türen stehen offen, manchmal muss ich längere Zeit nach der kleinen Schnecke suchen. Heute Morgen saß sie an der Decke meines Arbeitszimmers, das war zum ersten Mal, ich entdeckte sie nach einer Stunde, ich hatte sogar hinter den Kühlschrank geschaut, einen Tisch, drei Lampen, Stühle und zwei Kommoden verrückt. Eine Schnecke, mit einem Schneckenhaus auf dem Rücken, erscheint als äußerst zerbrechliches Wesen, gerade dann, wenn sie über einem Abgrund wandelt. Eine halbe Stunde begleitete ich Esmeralda auf ihrem Weg von Ost nach West. Ich hörte, wie ich mit ihr sprach. Esmeralda, sagte ich, Esmeralda! Hielt indessen einen Hut in der Hand, um Esmeralda im Notfall auffangen zu können. Gegen den Abend zu, sie hatte eine Weile in einem Meter Höhe an der Wand neben meinen Büchern ausgeruht, erreichte sie den Boden, kroch von West nach Ost quer durch mein Zimmer, um an der gegenüberliegenden Wand wieder zur Decke hin aufzusteigen. Ich lockte mit einem Stückchen Apfel, vergeblich. Ich zog Esmeralda an ihrem Häuschen von der Wand, setzte sie in der Küche neben einem Blatt Bataviasalates ab, auch das war nicht erfolgreich gewesen. Esmeralda wendete unverzüglich, kletterte vom Tisch, um am späten Abend genau jenen Ort wieder zu erreichen, den sie zuvor eingenommen hatte. Nach wie vor wundere ich mich darüber, dass Esmeralda ihr Gehäuse wie ein Schmuckstück auf dem Rücken zu tragen pflegt. Ich habe noch nie wahrgenommen, dass sie sich in ihr Häuschen zurückgezogen hätte. Ihr Körper ist feucht, ihre Stielaugen sinken manchmal zu Boden, das ist der Moment, da sie zu schlafen scheint. — stop
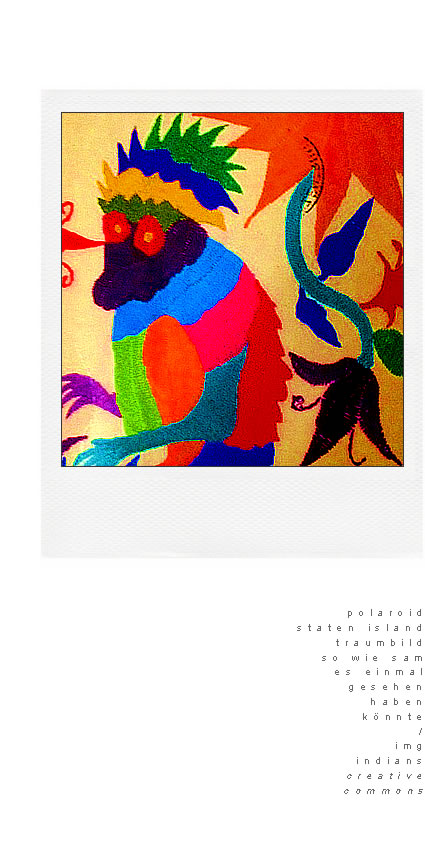
unter wasser
delta : 22.58 — Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn ich durch meine Wohnung tauchen könnte. Machte mich unverzüglich an die Arbeit. Zunächst stieg das Wasser in den Zimmern. Es kam nicht von oben, sondern von unten, das Wasser kam wie ein Gast durch die Wohnungstür herein, die geschlossen war, aber nicht wirklich dicht. Es stieg schnell, viel zu schnell, um meine Bücher noch in Sicherheit bringen zu können. Saß auf einem Stuhl in der Küche, die Füße auf dem Boden, als das Wasser, bernsteinfarben und warm, eine Steckdose erreichte. Ich erwartete, von einem Wandblitz getroffen zu werden, ein Irrtum. Stattdessen begann ich zu leuchten, zunächst leuchtete ich mit den Händen, dann leuchteten meine Arme. In dem Moment, da das Wasser meinen Mund erreichte, holte ich tief Luft und tauchte los. Eine Banane schwebte vorüber wie ein Fisch, Papiere und Zeitungen und zwei heftig zappelnde Mäuse, von deren Existenz ich nichts ahnte. Die Schreibmaschine auf dem Tisch funktionierte noch, wie alle Lampen in der Wohnung. Und so schwebe ich nun also gerade kopfüber und schreibe. Schöne Geräusche sind zu hören, es knistert, vielleicht bin ich das selbst. Später Abend. — stop
![]()
marías
~ : oe som
to : louis
subject : MARÌAS
date : aug 10 13 10.58 p.m.
Seit Noe eine Brille trägt, liest er zügig und fehlerfrei wie noch vor Monaten aus Büchern, die wir zu ihm in die Tiefe senden. Als ich ihn besuchte, war er müde von der Lektüre Javier Marías soeben eingeschlafen. Und so konnte ich für längere Zeit heimlich sein Gesicht betrachten hinter der Scheibe von gepanzertem Glas. Er ist blass geworden. Kein Wunder, kaum Sonnenlicht an der Grenze zur Finsternis. Während ich Noe betrachtete, wanderte eine Putzerschnecke über seine Stirn dahin. Sie stieg bald über Noes Nase abwärts, um kurz darauf in aller Seelenruhe seine linke Wange zu bewandern. Er scheint sich an die Existenz der Tiere auf seinem Körper gewöhnt zu haben, nach wie vor sind es fünf Schnecken. Er wird von ihren Berührungen niemals wach, selbst dann nicht, wenn sie sich um seine Lippen bemühen. Ich überlegte, wie der Geruch der Luft in Noes Anzug nach langer Zeit der Abgeschiedenheit beschaffen sein könnte. Ein Schwarm Haifüssliere näherte sich, neugierige Wesen? Vielleicht wurden sie von Noe angezogen, einem sich langsam durch das Zwielicht drehenden Finger. Er scheint zu flackern. Ich hatte vergessen, wie jung Noe doch ist. Ohne ihn aus der Nähe sehen zu können, nur seine lesende Stimme hörend, war der Taucher in meiner Wahrnehmung gealtert, ohne dass ich das bemerkte. Sein Gesicht ist schmal geworden. Ich vermochte seine Augenbälle zu erkennen, die sich unter ihren Lidern hin und her bewegten. Plötzlich sah er mich an. Er lächelte, und er sprach ein paar Wörter, die ich nicht verstehen konnte, obwohl ich nur wenige Zentimeter entfernt gewesen war. Ich antwortete, ich sagte: Noe, hör zu, Dein Vater ist gestorben. Da lachte Noe, vermutlich dachte er: Der Mann ist so nah und er spricht und doch kann ich nicht hören, was er sagt. Dann machte ich mich an die Arbeit. Ich befestigte Noes Brille an seinem Helm. — Dein OE SOM
gesendet am
10.08.2013
2188 zeichen
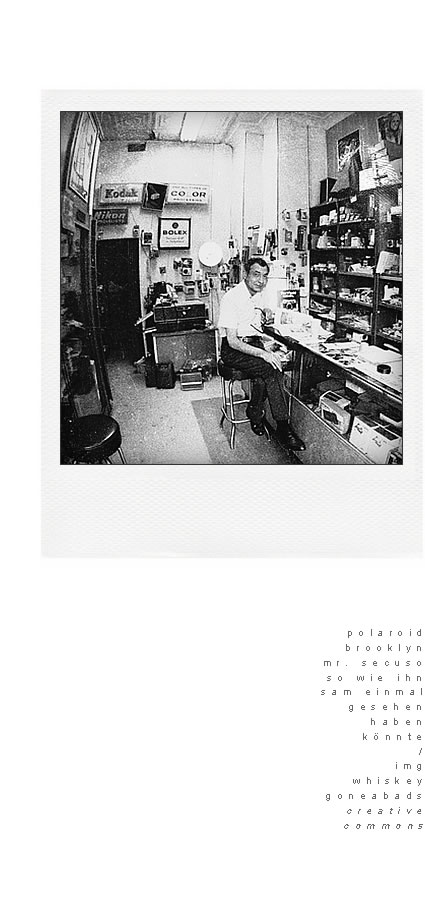
regen
ulysses : 6.06 — Gestern Abend telefonierte ich mit einer Freundin. Sie hatte kurz zuvor geschrieben, Hochwasser habe den Keller ihres Hauses erreicht. Sie erzählte, das Wasser komme nun durch zwei kleine Löcher in Boden und Wand herein, 5 Liter in einer halben Stunde. Ich hörte ihre Stimme, erschöpft, müde, sie wolle sich einen Wecker stellen und jede halbe Stunde Wasser schöpfen. Eine harte Sache, die noch einen Tag und eine ganze Nacht so weitergehen könne. Während wir sprachen, war das Geräusch tropfenden Wassers im Hintergrund zu vernehmen, als würde meine Gesprächspartnerin in einer Höhle sitzen, in einer entfernten Zeit, auf dem Mond oder auf dem Mars. Als ich klein und sehr unerfahren gewesen war, hatte ich die Vorstellung, nach starkem Regen könnte das Wasser in Telefonleitungen dringen. Ich wunderte mich deshalb, dass das Telefonieren nach Gewitterregen noch funktionierte. Wenn ich dann etwas später durch den Garten spazierte, meinte ich zu beobachten, wie unsere Telefonleitungen aus dem Boden flüchteten. Sie hatten sich zu Teilen aufgelöst und schlängelten, hellrote, glänzende Würmer, durch das feuchte Gras. Ich konnte sie berühren, und wenn ich sie ihn meine Hände nahm, kitzelte es sehr angenehm auf den Handflächen. Einmal setzte ich eine flüchtende Telefonleitung in ein Marmeladenglas. Es waren ein gutes Dutzend Würmer gewesen, die sich um Ausgang bemühten. Ich beäugte sie lange Zeit, die Wände des Glases beschlugen rasch, sodass ich das Glas immer wieder öffnen musste. Wenn ich mein Ohr an den Behälter drückte, konnte ich sie hören, einen eigentümlichen Laut der Not, für dessen Beschreibung ich bisher kein Wort entdeckte. Damals nahm ich das Glas mit in mein Zimmer. Ich stellte es unter mein Bett. Am nächsten Morgen hatte ich seine Existenz vergessen. — stop

winter
olimambo : 5.10 — Es ist sehr lange her, war noch Winter gewesen, als ich Mutter beobachtete, wie sie im Sessel vor Vaters Schreibtisch kauerte. Sie hatte sich getraut und seinen Computer angeschaltet. Ja, Vaters Computer lässt sich noch immer betreiben. Obwohl ich nicht damit gerechnet habe, dass mit dem Tod eines Menschen auch die Existenz seiner Uhren und Schreibbildmaschinen enden würde, wundere ich mich, wenn ich Vaters leise tickende Uhr an meinem linken Arm betrachte. Und das summende Geräusch seines Computers, er macht einfach weiter. Man stelle sich einmal vor, es wäre andersherum, mit dem Versagen der Computer würde auch das Leben ihrer Besitzer enden. Das wäre seltsam und sehr gefährlich in unserer Zeit. Aber es ist denkbar, dass einmal Computer existieren werden, die dreihundert Jahre alt werden oder noch älter, ohne dass ihnen das Licht ausgehen würde. Kurzum, Mutter saß vor dem Schreibtisch. Immer, wenn ich sie so sehe, bemerke ich, wie klein sie geworden ist, ohne dass ich selbst größer geworden wäre. Sie saß weit nach vorn gebeugt. Ich beobachtete ihre Hände, die versuchten, den Zeiger auf dem Bildschirm in nächster Nähe zu bändigen. Ihr Gesicht berührte beinahe den Bildschirm. Und als ich sie fragte, warum sie so seltsam dasitzen würde, sagte sie, dass sie die Buchstaben meiner Particles — Arbeit nur in dieser Weise lesen könne, sie seien viel zu klein und sie habe vergessen, wie man die Buchstaben vergrößern könne. Deshalb sind die Buchstaben meiner Particles — Arbeit grundsätzlich gewachsen und wir sind jetzt sehr zufrieden, weil wir wissen, dass die Größe der Buchstaben auf Bildschirmen manipuliert werden kann. — Weit nach Mitternacht. Der Himmel tropft und die Bäume und Dachrinnen und Vögel. Gegen drei Uhr hatte ich, wie aus heiterem Himmel, Lust auf gebratene Wachteln, warum? — stop
![]()
ryūnosuke akutagawa
charlie : 5.05 — Nach der möglichen Existenz von Drohnen im New Yorker Luftraum gefragt, soll der Bürgermeister der Stadt geantwortet haben, dass man solche Entwicklungen nicht aufhalten könne. „Wir werden mehr Sichtbarkeit und weniger Privatsphäre haben”. Es sei keine Frage, ob er selbst das gut oder schlecht finde. Das sei beängstigend, aber er sehe letztlich kaum einen Unterschied zwischen einer Drohne in der Luft und einer Kamera auf einem Gebäude.“ — In diesem Moment, es ist kurz nach drei Uhr, verlässt die Vorstellung eines Posaunisten, der frühmorgens an Bord der Fähre MS John F. Kennedy spielend einen neuen Morgen begrüßt, während er von einem summenden Flugobjekt in der Größe einer Mandarine umrundet wird, ihren poetischen Raum. — stop. — Minus 5 Grad Celsius. — stop. — Weit unter mir, auf einer Straßenlaterne, sitzt eine Amsel. Ich nehme an, dass sie mich sehen kann. Aber es ist noch zu kalt oder zu früh, um zu singen. Ich habe eine halbe Stunde lang in der Beobachtung des kleinen dunklen Vogelschattens mein Gedächtnis trainiert, indem ich versuchte, den Namen eines japanischen Dichters zu lernen, der seit dem 24. Juli 1927 nicht mehr am Leben ist. Er heißt Ryūnosuke Akutagawa. Jetzt ist es kurz vor vier. Nichts weiter. — stop



