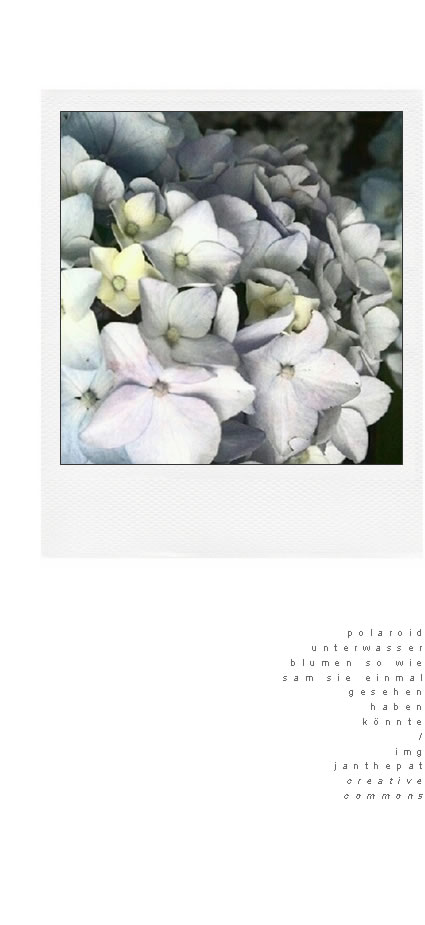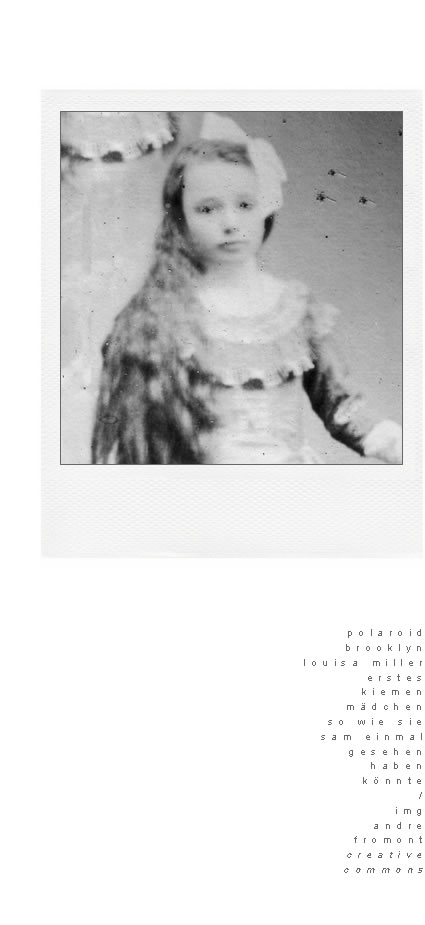![]()
delta : 0.12 — Henry erzählte, er habe vor einigen Wochen eine Kartonschachtel erworben für 80 Cent. Zu Hause habe er im Inneren der Schachtel einhundertundzwölf Schwarz-Weiß-Fotografien entdeckt, Fotografien einer Zeit um das Jahr 1965 herum. Menschen, die auf diesen Fotografien zu sehen sind, tragen Schuhwerk jener Jahre, Mäntel, Hüte. Auch Automobile, die da und dort im Hintergrund zu sehen sind, verweisen auf die Mitte eines Jahrzehntes, als Henry selbst geboren worden war. Er habe die Bilder nun digitalisiert und würde sie in wenigen Tagen auf einer Webseite veröffentlichen mit der Bitte, sich bei ihm zu melden, sobald man sich selbst auf einer der Fotografien entdecken würde. Ich wollte wissen, warum er so handele. Henry antwortete, er habe das Gefühl, diese Aufnahmen könnten vielleicht fehlen, irgendjemandem, einem Album, einer Geschichte. Ja, selbstverständlich sei ihm bewusst, dass nur durch einen Zufall seine Seite von genau jenen Menschen besucht werden würde, die sich wieder erkennen könnten, es gehe ihm rein um die Möglichkeit, dass sich dieser Zufall ereignen könne, er habe im Grunde die Möglichkeit eines Zufalles geschaffen. Eine der Fotografien soll ein hölzernes Feuerwehrauto zeigen, das von Kinderhand geführt über einen Teppich fährt. In dem Teppich sei ein Loch, das ihn an ein Brandloch erinnert habe. Eine weitere Aufnahme zeige eine Gardine, die sich im Wind zu bewegen scheine, im Hintergrund etwas Himmel, Wolken und ein Flugzeug. Und diese alte Frau, die auf einer Parkbank sitzt, sie wird, sagte Henry, vielleicht oder sehr sicher nicht mehr unter den Lebenden sein. Sie hält einen Fotoapparat, es könnte sich um eine Leica handeln, in ihren Händen. Die alte Frau lacht, es ist Sommer, sie lacht wie jene andere, etwas jüngere Frau, die auf einem steinigen Weg breitbeinig steht, ein Fuß ist zur Seite geknickt, auch sie hält eine Kamera, ein Leica vielleicht, ihn ihren Händen. — stop