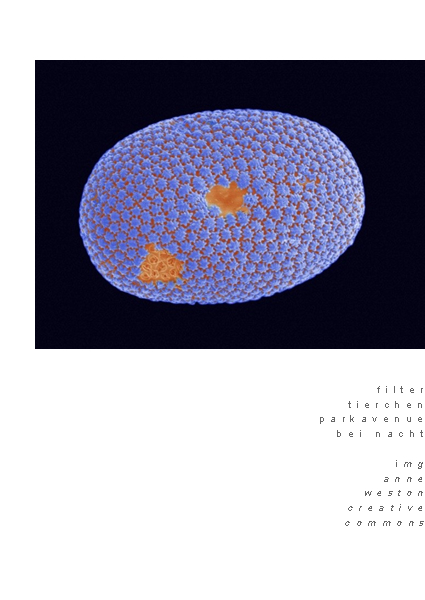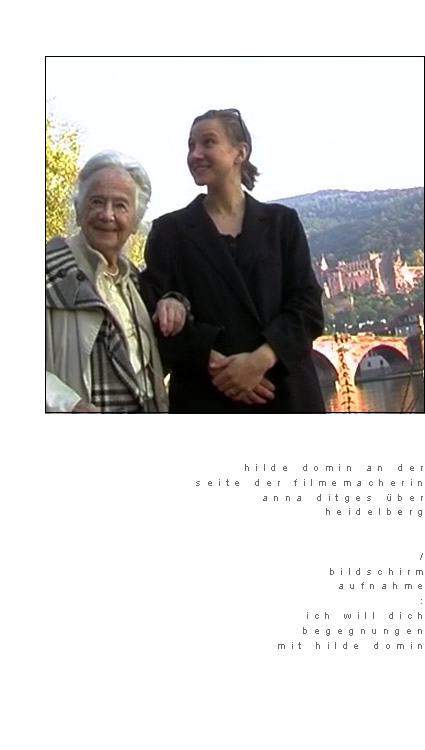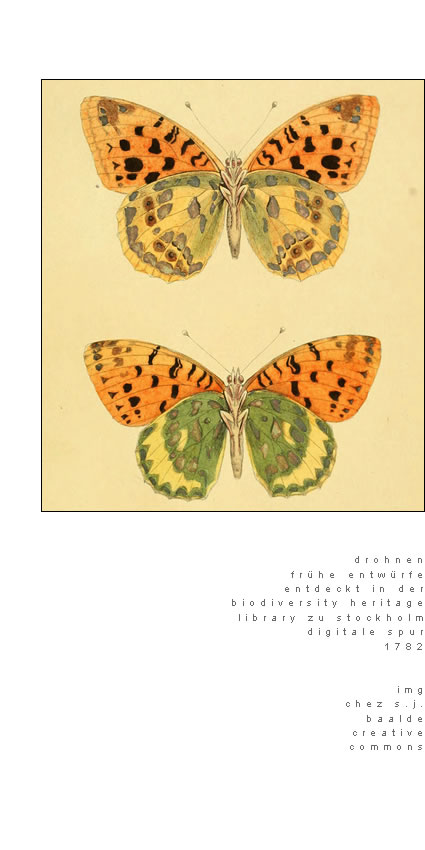tango : 15.06 UTC — Über einen langen Flur eines Schiffes wandernd, begegneten mir zwei Männer, ein junger und ein etwas älterer Mann. Wie sie näher kamen und ihre Stimmen in meinen Ohren deshalb lauter wurden, hörte ich, dass sie sich über ein Büro unterhielten, in welches einer der beiden Männer vor wenigen Tagen erst eingezogen war. Es ging in dem Gespräch außerdem um Möbel. Die Männer waren sich, so mein Eindruck, nicht ganz einig gewesen. Sie diskutierten, ein lautes, lachendes, ein lebendiges Gespräch, weshalb ich umdrehte und den Männern in dezentem Abstand folgte, ich wollte Ihnen heimlich zuhören, was vermutlich nicht ganz höflich gewesen war. Ich glaube, die zwei Männer bemerkten mich glücklicherweise nicht. Warum ist dein neues Büro so leer? Wollte der eine Mann, er war wirklich noch sehr jung gewesen, von dem anderen, dem älteren Mann wissen? Das ist so, antwortete der alte Mann dem jungen Mann, hör zu, ich will unabhängig leben von meinem Büro, ich will nicht mit ihm verwachsen sein. Wenn ich von meinem Büro einmal getrennt werden sollte, ist der Schmerz dann nicht so groß, wenn ich aber mit meinem Büro verwachsen sein würde, könnte man mir Schmerzen zufügen, man könnte sagen, Sie dürfen bleiben, wenn sie folgsam sind, man könnte mich erpressen, verstehst Du, man könnte mich mit leichter Hand fertig machen. Deshalb sind in meinem Büro nur ein Stuhl und ein Tisch und Papiere, ein Obstkorb, eine besondere Tafel, die beschriftet werden kann und wieder gereinigt von Farbe, eine Zeichnung weiterhin, die einen Mann zeigt, der sein Fahrrad zerlegte, außerdem sind da noch, eine Kaffeetasse, drei Stühle für Gäste, ein kleiner Kühlschrank, ein Regal mit 176 Büchern, ein Teppich, welchen ich auf einer Reise nach Marokko entdeckte, eine Stehlampe, die sich gleich hinter meinem Schreibtisch befindet, ein wunderbar warmes Licht strömt von dort, eine zweite Lampe auf dem Schreibtisch, die im Winter zusätzlich Licht spenden wird, ein kleines Sofa, Bleistifte in einem Bleistiftgefäß, ein Telefon, zwei Kakteen, fünf Orchideen auf der Fensterbank, ein Käfig mit einem Zeisigpärchen, drei Schreibmaschinen, eine Fotografie, die meine Geliebte zeigt, wie sie lächelt, ist das nicht wunderbar. — stop