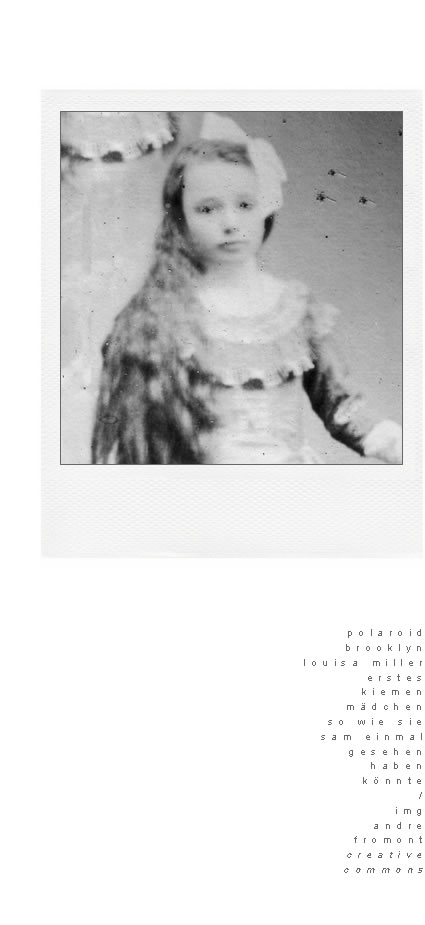![]()
delta : 2.42 — Von Eleonore weiß ich nichts, außer, dass sie über winzige Hände verfügt. Das ist nicht viel, nein, nicht viel, vielleicht sollte ich erwähnen, dass sie die Luft sehr lange Zeit anzuhalten vermag. Ich habe vor Kurzem noch mit ihr das Luftanhalten geübt, wie saßen voreinander und lachten, dann sagte sie: Jetzt, und schloss ihren Mund. Auch ich schloss meinen Mund, ich machte einen Strich aus ihm in meinem Gesicht. Es war natürlich Ehrensache, dass in der Zeit unseres Wettkampfes weder von ihr noch von mir durch die Nase geatmet wurde. Zunächst übten wir eine Minute, dann zwei, bis dahin hatten wir uns nur gewärmt oder entspannt, um sehr bald 2 Minuten und dreißig Sekunden lang die Luft anzuhalten, was mir bereits Schmerzen bereitete, ich musste mich konzentrieren, während Eleonore mich völlig entspannt betrachtete. In der Disziplin eines Atemstillstandes von drei Minuten und dreißig Sekunden senkte sie ihre Augen, nicht weil sie kämpfen musste, sondern weil sie meine Hände beobachtete, die ein wenig zitterten, ich hatte sie zu Fäusten geballt, ein Zeichen, dass ich bald aufgeben würde, wie man mir später erzählte. Das war nach meiner zweiten Ohnmacht gewesen, ich wurde nämlich schläfrig nach 3 Minuten und 45 Sekunden, sowie nach einer Übung von über 4 Minuten. Hier endete unser gemeinsames Training, weil Eleonore nicht weitermachen wollte, da ich kein ernstzunehmender Gegner für sie war. Stattdessen durfte ich ihr zusehen, wie sie versuchte, in ihrer Lieblingsdisziplin, der Langzeitstrecke von über sechs Minuten, eine schwierige Rechenaufgabe zu lösen. Sie notierte ein Ergebnis, eine größere Zahl, auf ein Blatt Papier in der achten Minute, und sank dann lautlos in ihrem Stuhl in sich zusammen, wo sie in dieser Minute noch immer sitzt und fest zu schlafen scheint. Mehrfach habe ich versucht, sie zu wecken, indem ich ihren Namen rief. Mit jedem meiner Rufe wuchs die Furcht, sie zu berühren. Es ist jetzt eine halbe Stunde vergangen, draußen vor dem Fenster summt eine kalte Nacht. Nein, nein, ich bin nicht wirklich beunruhigt, denn ich meine zu erkennen, dass sich Eleonores Brüste heben und senken. Auch ihre Hände scheinen sich leicht zu bewegen. Sie sind tatsächlich außerordentlich klein, es sind die Hände eines Mädchens an den Armen einer erwachsenen Frau, und sie sind weiß, ich erinnere mich, sie waren schon immer sehr weiß gewesen. — stop