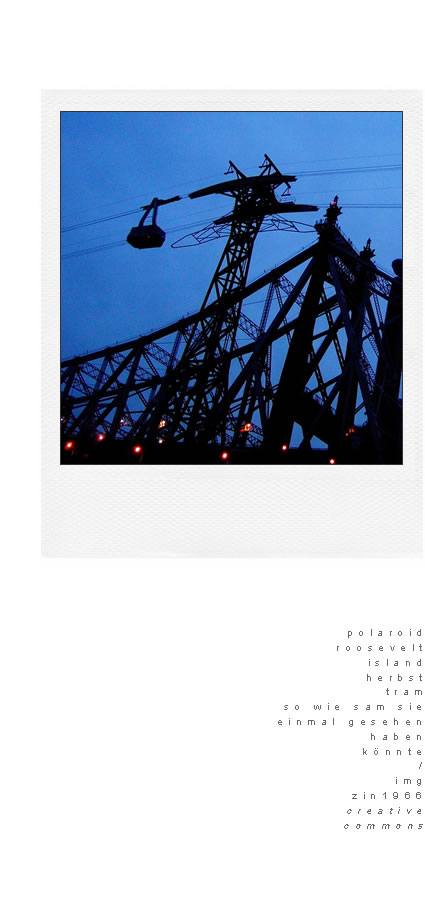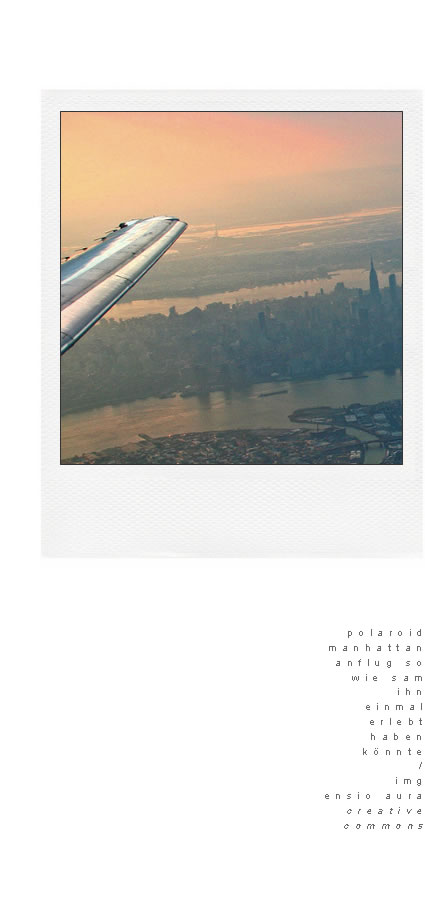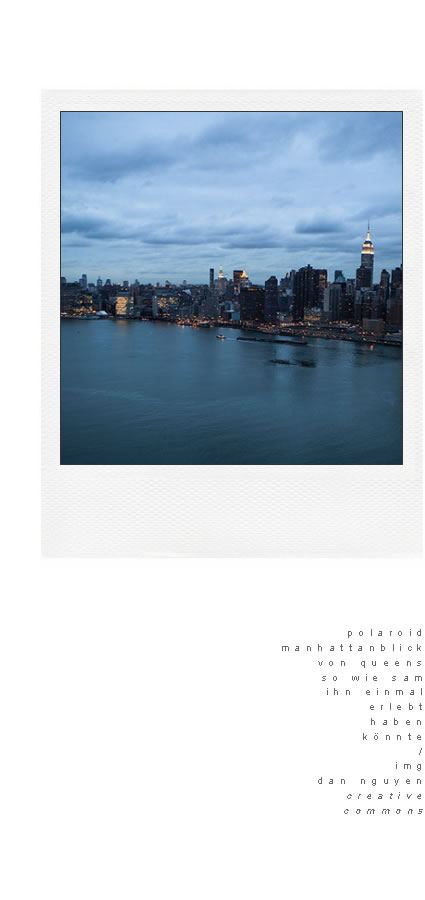delta : 0.08 — Ich erinnerte mich an einen Mann, dem ich vor zwei Jahren in einem New Yorker U‑Bahnzug begegnet war. Der Mann saß gleich vis-à-vis, sein Rücken lehnte an der Wand des Waggons, er hatte die Beine übereinander geschlagen, trug ramponierte, blaue Turnschuhe, und einen hellgrauen Anzug, ein weißes Hemd zudem, sowie eine grellbunte Krawatte, deren Knoten locker vor einem langen, schmalen Hals schaukelte. Ich hatte damals den Eindruck, dass der Mann sich freute, weil ich ihn beobachtete, indem er Zeitungen durchsuchte, die sich auf dem Sitzplatz neben ihm türmten, und zwar in einer sehr sorgfältigen Art und Weise durchsuchte, jede der Zeitungen Seite für Seite. Er schien Übung zu haben in dieser Arbeit, seine Augen bewegten sich schnell und ruckartig, wie die Augen eines Habichts, hin und her. Von Zeit zu Zeit hielt er inne, sein Kopf neigte sich dann leicht nach vorn, um mit einer Schere einen Artikel oder eine Fotografie aus der Zeitung zu schneiden. Das Rascheln des Papiers. Und das helle, ziehende Geräusch der Schere, wie es die Seiten zerteilte. Ich notierte in mein Notizbuch: Ein verrückter Mann, ich werde ihm nie wieder begegnen. Diese Notiz habe ich heute bemerkt unter weiteren Notizen, die sich mit dem geduldigen Schlafen in U‑Bahnzügen beschäftigen. Ich frage mich nun, wie ich darauf gekommen sein könnte, den beobachteten Mann als verrückt zu bezeichnen. Vielleicht deshalb, weil ich mir vorgestellt hatte, wie der Mann leben könnte. Ich glaube, ich stellte mir das Leben eines Verrückten vor. In seiner Wohnung türmten sich Zeitungen, Tische, Stühle, Schränke existierten nicht, aber ein Bett, das von Papieren bedeckt war. Auch in der Wohnung, oder gerade eben dort, wurden Zeitungen durchsucht, neuere oder ältere Zeitungen, die der Mann während seiner täglichen Spazierfahrten durch die Stadt mit sich nahm. Eigentlich las der Mann die Zeitungen nicht wirklich, sondern nur Überschriften. Sobald er eine bemerkenswerte Überschrift entdeckte, wurde der dazugehörende Artikel gesichert, Artikel, die sich beispielsweise mit Blumen, Afrika, Ozeanografie, Geheimdiensten, Waffensystemen, Hungersnöten oder erzählender Literatur beschäftigten. Hunderttausende Schriftstücke waren so über viele Jahre gesammelt worden, eine faszinierende Tätigkeit, eine Arbeit, die den Mann glücklich gemacht haben könnte, ich vermute, weil er vor sich selbst verheimlichte, dass er seine gesammelten Dokumente niemals lesen wird, weil seine Lebenszeit nicht ausreichte, selbst dann nicht, wenn er das Sammeln einstellen und mit der Lektüre seiner Beweisstücke ohne Verzug beginnen würde. — stop
![]()