india : 0.28 — Es ist nicht lang her, es war im Dezember gewesen, als ich einen Text notierte, der vom Tod eines Freundes erzählte. Ich hatte damals noch keine wirkliche Erklärung, weswegen das Leben meines Freundes endete, aber eine Vermutung, eine Befürchtung. Ich notierte so: „Ich war einmal dabei, wie Teddy seine Kamera in den Park spazieren führte, an einem kalten, winterlichen Tag, es hatte geschneit. In den Händen des stattlichen runden Mannes sah der Fotoapparat, der einen Computer enthielt, klein aus, zerbrechlich. Unentwegt berichtete sein stolzer Besitzer von den Möglichkeiten der Fotografie, die diese Kamera in Zukunft für ihn eröffnen würde. Es war eine Art Liebesbeziehung, die ich damals beobachtete, Teddy und seine kleine Lichtfangmaschine, wie er mit seinem dritten Auge den Schnee betastete, wie er mir erzählte, dass man Schnee eigentlich nicht fotografieren könne. Das war vor vier oder fünf Jahren gewesen. Seither sind Teddy und seine Kamera weit herumgekommen in der Welt, vorwiegend reisten sie nach Peking, verbrachten dort mehrere Monate im Jahr, wanderten durch die große Stadt auf der Suche nach Augenblicken, die Teddy sammelte. Es war ein Fotografieren wie ein Gespräch, auch ein Selbstgespräch gegen die Verlorenheit, gegen die Angst vielleicht einmal wieder in den Alkohol zurückzufallen, jedes Bild ein Beweis für die eigene Existenz. Eine seiner Fotografien aus dem Sommer 2012 zeigt zwei Jungen, wie sie dem riesigen, runden Mann mit dem kleinen Fotoapparat begegneten. Der eine Junge scheint zu staunen, der andere will die rechte, seitwärts ausgestreckte Hand des Fotografen berühren. Es ist eine typische Fotografie, das Werk eines Künstlers, der manchmal in Europa anrief, weil er sich einsam fühlte in irgendeinem Hotel der chinesischen Provinz bei Eis und Schnee. Auch in Peking hatte er Freunde, gute, wirkliche Freunde, in seiner kleinen Wohnung dort wohnten eine junge Studentin und ihre Mutter. Vor wenigen Tagen erreichte mich nun die Nachricht seines Todes, für den es zu diesem Zeitpunkt keine Erklärung gibt. Auf Facebook notierte er noch: Bitte beachte, dass ich prinzipiell keine Nachrichten schreibe oder beantworte. Verwende bitte immer meine E‑Mail-Adresse, um mich zu erreichen. Per Mail bin ich stets zu erreichen.“ – Nun habe ich eben genau durch eine E‑Mail erfahren, woran Teddy gestorben ist. Eine chinesische Freundin Teddys schrieb: Hallo! Ich bin Li Bin. Erinnerst du dich an mich, die gute chinesische Freundin von Teddy. Es tut mir so Leid, dass Teddy am 22. November in Peking gestorben ist, weil er zu viel Alkohol getrunken hat. Als ich die Nachricht gehört habe, fand ich mich sehr überrascht. Eigentlich hatte ich mich mit Teddy verabredet, am 22. November nach Peking zu fahren und seine Fotoausstellung zu besuchen. Aber noch vor der Abfahrt haben andere Freunde mich angerufen, dass Teddy schon gestorben ist. Sofern ich das beurteilen kann, hat er nicht für lange Zeit Alkohol getrunken, aber sehr viel. Deswegen war er schon einmal im Krankenhaus in Peking. Damals war es schon sehr schlimm, trotzdem hat er nicht aufgehört, zu trinken. Andere Freunde haben erzählt, er hatte früher die Krankheit, die Abhängigkeit vom Alkohol. Aber Teddy hat mit mir das nie besprochen. So warten wir jetzt auf das Ergebnis der Polizei. — stop

Aus der Wörtersammlung: jahre
lufträume
bamako : 6.30 — Der Stuhl meines Vaters im Zimmer vor den Bäumen. Sobald ich mich setze, spüre ich seine Gegenwart, als wäre er gerade erst aufgestanden, um kurz in ein anderes Zimmer zu gehen. Genau dieser Ort, ja, dieser Raum, so viele Jahre, so viele Stunden lang hatte mein Vater an dieser Stelle verbracht, dass er nur sehr langsam weichen kann in der Wahrnehmung seines Sohnes. Da ist seine Schublade, sein Lichtmessgerät, sein Brieföffner, sein Radiergummi, sein Bleistift, seine Lupe, sein Fotoapparat. Und das hier ist seine Aussicht auf den winterlichen Garten, auf den Computerbildschirm, auf die Tastatur seiner Schreibmaschine, auf seine Lampe, die noch immer warmes Licht ins Zimmer sendet, Licht, das mein Vater sich wünschte. Es ist eine seltsame Erfahrung, dass sich mit den Spuren eines Menschen spürbare Gegenwart verbindet. Das Geräusch einer Zeitung, die raschelt. Eine Tür, die sich öffnet. Vor wenigen Tagen noch hörte ich meine Mutter davon erzählen, wie sehr ihr mein Vater fehle. Und weil die Worte nicht ausreichten, dieses Fehlen zu beschreiben, machte sie eine sehnende Geste, als würde sie einen unsichtbaren Mann umarmen, einen Raum, der nur noch Erinnerung ist, einen Raum, der weder mit Händen noch Lippen berührt werden kann. — stop
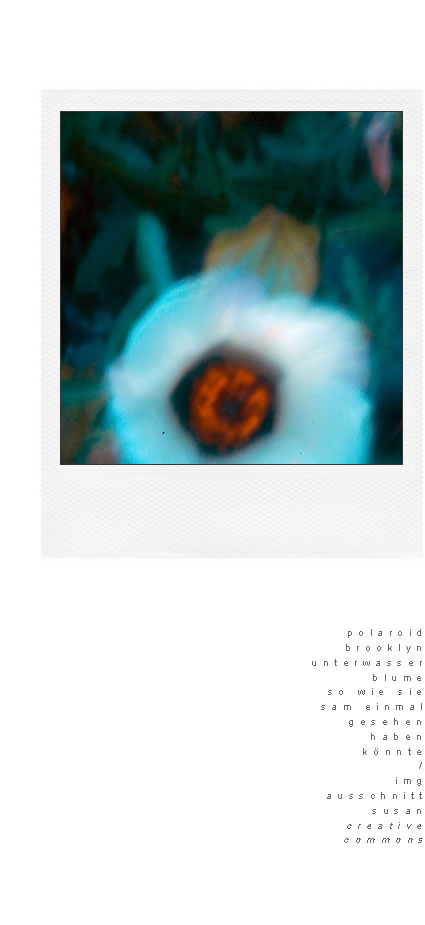
PRÄPARIERSAAL : feuerherz
nordpol : 7.07 — In der vergangenen Nacht habe ich in meinen Verzeichnissen nach einem E‑Mailbrief gesucht, den mir eine junge Frau, Lidwien, vor einigen Jahren notiert hatte. Ich konnte den Brief nicht finden, keine meiner Suchmaschinen, weil ich den Brief versehentlich ohne Namen abgelegt hatte. Ich erinnere mich noch gut an Lidwien. Sie war eine zierliche, freundliche und zielbewusste Person, die mit einem leicht französischen Akzent formulierte. Ich hatte sie einmal beobachtet, wie sie im Präpariersaal mit ihren Händen in einem Säckchen wühlte, um kurz darauf innezuhalten und die Augen zu schließen. In dem Säckchen, das von schwarzem, lichtundurchlässigem Stoff gewesen war, befanden sich Knochen einer Hand. Es war die Aufgabe Lidwiens gewesen, unter den Knochen einen bestimmten Knochen zu finden und durch reines Tasten eindeutig zu identifizieren. Ich beobachtete die junge Frau, wie sie während ihrer Suche in dem strahlend hellen Licht des Saales stehend die Augen schloss, als ob sie in dieser Weise mit ihren Fingerspitzen in der Dunkelheit des Säckchens besser sehen könnte. Ein Gespräch folgte über Bilder, die der Saal in Lidwiens Geist erzeugte. Kurz darauf erhielt ich einen Brief, in dem sie ihre Gedanken präzisierte. Genau diesen Brief suchte ich vergeblich, dann erinnerte ich mich an den Titel eines Films, von dem die junge Frau berichtet hatte, und schon war der Brief in meinen Archiven aufzuspüren gewesen. Lidwien notierte unter anderem Folgendes: Wissen Sie, auf die Frage, ob die Bilder aus dem Saal in meinen Alltag hinübergleiten, kann ich mit einem total aufrichtigen NEIN antworten. Ich habe überlegt, wie das überhaupt sein kann, da muss ein Filter sein und ich finde diesen Filter in meinem Gehirn wirklich faszinierend. Neulich habe ich ein Interview mit einer ehemaligen Kindersoldatin aus dem Sudan gesehen, die eine Biografie mit dem Titel FEUERHERZ geschrieben hatte. Dramatische Dinge muss sie erlebt und für uns nahezu unvorstellbare Bilder gesehen haben. Auf die Frage, wie sie mit diesen grausamen Bildern umging, antwortete sie: Ich habe diese Bilder nicht besonders verarbeitet, denn ES WAR UNSER ALLTAG UND WIR WAREN ES NICHT ANDERS GEWOHNT. Ich habe diese Aussage mit meinen Erfahrungen in Beziehung gesetzt. Von dem Moment an, da ich die Präparierhallen regelmäßig betrete und viele Stunden des Tages darin verbringe, werden all die toten Körper, all die Präparate, die man auf ungewohnte und seltsame Weise mit den eigenen Händen bewirkt, ja gerade zu erschafft, und der beißende Geruch des Formalins, zu meinem Alltag. In diesem Alltäglichen, in der Routine, verlieren menschliche Emotionen und die dazugehörigen Bilder an Gewicht und Polarität: Aus leidenschaftlicher Liebe wird Freundschaft und Zusammenhalt, und aus Angst und Furcht wird Fatalismus und Gelassenheit. – Und deshalb bleiben meine Bilder im Saal und ich lasse sie dort, wenn ich nach Hause zu meiner Familie gehe. — stop

josephine besucht chelsea
ulysses : 15.07 — Ich erinnere mich an einen Tag im Mai des Jahres 2010, als Josephine und ich durch den Central Park spazierten. Es war ein warmer Tag gewesen, ein Tag, an dem Waschbären ihre Verstecke im Unterholz flüchteten, um den Sommer zu begrüßen. Nie zuvor hatte ich Waschbären persönlich gesehen, und auch an diesem Tag hatte ich kaum Zeit, sie zu beobachten, weil die betagte Dame an meiner Seite südwärts drängte. Gut gelaunt schien sie ihr Alter nicht im mindesten zu spüren, und so folgten wir der 8th Avenue Richtung South Ferry, passierten die Port Authority Busstation, das zentrale Postamt und die Penn Station, um nahe dem Joyce-Theater in die 18th Straße einzubiegen. Beinahe zwei Stunden waren wir bis dorthin unterwegs gewesen, es dämmerte bereits. Vor dem Haus 264 West blieb Josephine stehen. Sie holte ihr Telefon aus der Handtasche und meldete mit lauter Stimme, dass sie bereits unten vor dem Haus stehen würde und abgeholt zu werden wünsche! Ein Herr, in etwa demselben Alter, in dem sich Josephine befand, öffnete uns kurz darauf die Tür. Er war mit einem Hausmantel bekleidet, der in einem tiefen Blau leuchtete, hatte keinerlei Haar auf dem Kopf und trug Turnschuhe. Ich erinnere mich, dass ich mich wunderte über seine großen Füße, denn der Mann, den mir Josephine mit dem Namen Valentin vorstellte, war eher zierlich, wenn nicht klein geraten. Während wir eine enge Treppe in den sechsten Stock hinaufstiegen, dachte ich an diese Schuhe und auch daran, ob ich selbst in ihnen überhaupt laufen könnte. Bald traten wir durch eine schmale Tür, hinter der sich ein Raum von unerwarteter Größe befand, ein Saal vielmehr, mit einer hohen Decke und einem gut gepflegten Boden von Holz, der nach Orangen duftete. Linker Hand öffnete sich ein Fenster, das die gesamte Breite des Raumes füllte, mit einem großartigen Ausblick auf Chelsea, auf Dachgärten, Antennen und Satellitenwälder, ich glaubte, vor einer Stadt ohne Straßen zu stehen. Und da war nun dieser alte Mann in seinem blauen Hausmantel, der uns bat, auf einem Sofa Platz zu nehmen, welches das einzige Möbelstück gewesen war, das ich in dem Raum entdecken konnte. Ein paar Wasserflaschen reihten sich an einer der Wände, die von Backstein waren, von hellem Rot, und an diesen Wänden waren nun Papiere, Fotokopien von Buchseiten, genauer, akkurat aneinander gereiht, sodass sie die Wände des Saales bedeckten. Josephine schien sehr berührt zu sein von diesem Anblick. Sie saß mit durchgedrücktem Rücken auf dem Sofa und bewunderte das Werk ihres Freundes, der uns zu diesem Zeitpunkt bereits vergessen zu haben schien. Er stand vor einer der Buchseiten und las. Es handelte sich um ein Papier des 1. Band der Entdeckungsreisen nach Tahiti und in die Südsee von Georg Forster in englischer Übersetzung. Und wie wir den alten Mann beobachteten, erzählte mir Josephine, dass er das mit jedem der Bücher machen würde, die er lesen wolle, er würde sie entfalten, ihre Zeichenlinie sichtbar machen, er lese immer im Stehen, er sei ein Wanderer. — stop

eine alte frau
![]()
delta : 7.28 — Eine alte Frau in den Schuhen eines Mannes. Sie ist klein, sie geht gebückt. Der Mann, zu dem früher einmal die Schuhe der alten, gebückt gehenden Frau gehörten, muss ein Mann von stattlicher Größe gewesen sein. Sie kann ihre Füße nicht vom Boden heben, ohne den schützenden Raum der riesigen Schuhe zu verlassen. Deshalb geht sie in einer Weise, als sie würde auf Skiern laufen. Links in der Hand trägt sie einen Stock, auf den sie sich stützt, sobald sie einmal stehen bleibt. Sie trägt einen grauen Wintermantel, graue Hosen, einen grauen Schal. Auch ihr Haar ist von grauer Farbe. Eigentlich fällt sie kaum auf in der Menschenmenge, weil sie zierlich ist und ohne Laut. Sie wandert in ihren Schneeschuhen über den Zentralbahnhof von Mülleimer zu Mülleimer, um jeweils in die Tiefe der Behälterschlünde zu spähen. Ich frage mich, was sie suchen könnte, vielleicht Flaschen oder ein Brot oder den Rest eines Apfels. Ich kenne die Erscheinung dieser Frau, ich kenne sie seit Jahren. Sie ist ein Leichtgewicht, wenn ich sie mit den schweren, den vollständig vermummten Gestalten der New Yorker Straßen in Beziehung setze. Als ich sie zum ersten Mal wahrgenommen habe, dachte ich: Diese Frau könnte meine Mutter sein, was ist geschehen? Damals sah die alte Frau krank aus und schmutzig und sie roch sehr streng. Ihre Augen waren gelblich verfärbt, daran erinnere ich mich genau, ich überlegte, ob sie vielleicht bald sterben wird. Das war vor zwei oder drei Jahren gewesen. Wie ich sie heute wieder sehe, die alte Frau in den Schuhen eines Mannes, denke ich, sie ist wie eine Figur, die immer irgendwo in Bahnhöfen anwesend ist, die immer wieder über eine dieser Reisebühnen schreitet, ohne je weiterzufahren, diese Wege von Mülleimer zu Mülleimer und wieder zurück auf der Suche nach etwas Nahrung oder Pfand. An diesem Abend überhole ich sie, wende und bücke mich, sodass ich ihr nahekomme. Sie hält an, schaut mir in die Augen. Ihre Haut ist weich und weiß und ihre Pupillen sind klar. Ich sage: Entschuldigen Sie bitte. Darf ich ihnen etwas geben? In dem Moment, da sie mir eine Hand entgegenstreckt, sagt sie mit der Stimme eines Mädchens so hell: Danke, warum? — stop

vor den kapverden
![]()
delta : 6.58 — Vor zwei Jahren einmal meldete sich mein Vater am Telefon, er wollte mir einige Gedanken übermitteln. Ich hatte ihn gefragt, ob es Tiefseeelefanten in physikalischer Hinsicht möglich sei, Atemluft über kilometerlange Rüssel in die Tiefe zu leiten. Mein Vater sendete mehrere Varianten einer Lösung dieses Problems, unter anderem dachte er darüber nach, dass die Luft gegen den steigenden Druck des Wassers vermutlich in einem Kammersystem in kleineren Portionen nach unten gedrückt werden könnte. Das leuchtete mir ein, ich war sehr zufrieden mit dieser Vorstellung eines Lufttransportwesens. In der vergangenen Nacht habe ich mich an die Vorstellungen meines Vaters erinnert, in einer Nacht, da ich Meldung erhielt, man habe vor den Kapverden Tiefseeelefanten gesichtet. Wieder ein Fischerboot, wie es sich in einer leichten Meeresströmung dreht. Schweigende Männer. Lampenlicht, das über das Wasser springt. Die Männer betrachten auch in diesen Minuten der Nacht schnaubende Rüsselspitzen einer riesigen Herde Tiefseeelefanten, die sich vielleicht soeben auf den Weg begeben, den Atlantik zu durchqueren, geräuschvoll atmende, sich liebkosende, samtig fleischige Knitterblüten. — Leichter, kühler Regen. – stop

eine sprechende maschine
![]()
remington : 6.52 — Vor wenigen Tagen hatte ich von der Entdeckung eines Museums der Nachthäuser erzählt, das sich am Shore Boulevard nördlich der Hell Gates Bridge befindet, die den Stadtteil Queens über den East River hinweg mit Randilis Island verbindet. Es ist noch immer ein recht kleines Haus, rote Backsteine, ein Schornstein, der an einen Fabrikschlot erinnert, ein Garten, in dem verwitterte Apfelbäume stehen, der Fluss so nah, dass man ihn riechen kann. Heute liegt der Garten tief verschneit. Ich stehe unter einem der Apfelbäume, die ohne Blätter sind. Dieser Baum trägt seine Sommerfrüchte so, als ob er sie festhalten würde, sie sind etwas kleiner geworden, voller Falten, aber sie leuchten Rot und sie duften. Der junge Mann, der mich bereits einmal durch das Museum geführt hatte, kommt in diesem Moment auf mich zu. Er freut sich, dass ich wiedergekommen bin. Eine Weile stehen wir uns gegenüber, es ist zum Erbarmen kalt, wir treten von einem Bein aufs andere, während der junge Mann eine Zigarette raucht, dann ist es fast dunkel und wir treten wieder in das Museum ein. Er möchte mir eine kleine Maschine zeigen, die im ersten Stock seit vielen Jahren in einer weiteren Vitrine sitzt. Auf den ersten Blick scheint es sich um eine ähnliche Apparatur zu handeln, wie jene von der ich berichtete. Ein Gecko von Metall, der in der Lage ist, sich zum Zwecke protestierender Kommunikation Wände hinauf an die Decke eines Zimmers zu begeben, um sich dort festzusaugen. Aber anstatt eines oder mehrerer Schlaginstrumente, mit welchen gegen die Decke getrommelt werden könnte, verfügt dieses kleine Wesen über einen Lautsprecher, der wie ein Mund gestaltet ist, und deshalb hervorragend geeignet zu sein scheint, heftige Geräusche des Sprechens zu erzeugen. Bei dieser Apparatur, sagt der junge Angestellte, handelt es sich um den ersten Deckensprecher der Geschichte, ein äußerst sinnvolles Gerät. Er fordert mich auf, näherzutreten. Sehen Sie genau hin, sehen Sie, er ist verbeult! Tatsächlich war der kleine eiserne Gecko von zahlreichen Schlägen so verletzt, dass er vielleicht kaum noch in der Lage gewesen war, seiner Aufgabe nachzukommen. Denkbar ist, dass er in einer Nacht der Tagmenschen derart wirkungsvoll gearbeitet haben könnte, dass man ihn fangen wollte, weshalb man in die Wohnung des Nachtmenschen eingebrochen war, um ihn zum Schweigen zu bringen. Als man das ramponierte Gerät viele Jahre später öffnete, entdeckte man eine Tonbandspule, auf welcher Literatur von Bedeutung festgehalten war. Ein Bruchstück der historischen Aufnahme war noch vorhanden gewesen, und jetzt, in dieser Nacht, spielt mir der junge Mann vor, was der Apparat gesprochen hatte. Eine äußerst laute, scheppernde Stimme ist zu vernehmen: Zuerst wollte er mit dem unteren Teil seines Körpers aus dem Bett hinauskommen, aber dieser untere Teil, den er übrigens noch nicht gesehen hatte und von dem er sich keine rechte Vorstellung machen konnte, erwies sich als zu schwer beweglich; es ging so langsam; und als er schließlich, fast wild geworden, mit gesammelter Kraft, ohne Rücksicht sich vorwärts stieß, hatte er die Richtung falsch gewählt, schlug an dem unteren Bettpfosten heftig an, und der brennende Schmerz, den er empfand, belehrte ihn, dass gerade der untere Teil augenblicklich vielleicht der empfindlichste war. — Hier endet die Spule, ums sofort wieder von vorn zu beginnen. — stop

tod in peking
![]()
tango : 0.25 — Ich war einmal zugegen, als Teddy seine Kamera in den Park spazieren führte, an einem kalten, winterlichen Tag, es hatte geschneit. In den Händen des stattlichen runden Mannes sah der Fotoapparat, der einen Computer enthielt, klein aus, zerbrechlich. Unentwegt berichtete sein stolzer Besitzer von den Möglichkeiten der Fotografie, die diese Kamera in Zukunft für ihn eröffnen würde. Es war eine Art Liebesbeziehung, die ich damals beobachtete, Teddy und seine kleine Lichtfangmaschine, wie er mit seinem dritten Auge den Schnee betastete, wie er mir erzählte, dass man Schnee eigentlich nicht fotografieren könne. Das war vor vier oder fünf Jahren gewesen. Seither sind Teddy und seine Kamera weit herumgekommen in der Welt, vor allem reisten sie nach Peking, verbrachten dort mehrere Monate im Jahr, wanderten durch die große Stadt auf der Suche nach Augenblicken, die Teddy sammelte. Es war ein Fotografieren wie ein Gespräch, auch ein Selbstgespräch gegen die Verlorenheit, gegen die Angst vielleicht einmal wieder in den Alkohol zurückzufallen, jedes Bild ein Beweis für die eigene Existenz. Eine seiner Fotografien aus dem Sommer 2012 zeigt zwei Jungen, wie sie dem riesigen, runden Mann mit dem kleinen Fotoapparat begegneten. Der eine Junge scheint zu staunen, der andere will die rechte, seitwärts ausgestreckte Hand des Fotografen berühren. Es ist eine typische Fotografie, das Werk eines Künstlers, der manchmal in Europa anrief, weil er sich einsam fühlte in irgendeinem Hotel der chinesischen Provinz bei Eis und Schnee. Auch in Peking hatte er Freunde, gute, wirkliche Freunde, in seiner kleinen Wohnung dort wohnten eine junge Studentin und ihre Mutter. Vor wenigen Tagen erreichte mich nun die Nachricht seines Todes, für den es zu diesem Zeitpunkt keine Erklärung gibt. Auf Facebook notierte er noch: Bitte beachte, dass ich prinzipiell keine Nachrichten schreibe oder beantworte. Verwende bitte immer meine E‑Mail-Adresse, um mich zu erreichen. Per Mail bin ich stets zu erreichen. – Lieber Teddy, ich werde das sofort versuchen. — stop

schildkröte
![]()
nordpol : 6.55 — Ich hörte eine Geschichte, die von einer Frau und einem Haus erzählt, das sich in einer alten nordgriechischen Stadt befindet. Es ist ein stattliches, steinernes Haus, die Böden des Hauses sind von Holz wie die Treppen und Türen. Ein hochbetagter Olivenbaum steht unweit des Hauses. Manchmal sitzen dort Sperlinge und pfeifen. Im Winter kann man Wölfe hören, wenn man die Fenster des Hauses öffnet. Gelegentlich kommen Schlangen zu Besuch und Eidechsen und Ameisen und Schildkröten, ja, es gibt sehr viele Schildkröten im Garten des Hauses, aber nicht im Winter, in keinem Winter, soweit Menschen zurückdenken können, hat irgendjemand Schildkröten in der Nähe des Hauses, im Garten oder in der Stadt gesehen. In dem steinernen Haus also wohnt eine Frau. Sie wohnt seit wenigen Wochen allein, weil ihre Mutter gestorben ist. Über zehn Jahre lag die uralte Mutter in ihrem Bett und wurde von ihrer Tochter, die gleichwohl eine ältere Frau ist, gepflegt. Das ist so üblich in Griechenland, dass sich die jüngeren um die älteren Menschen kümmern, auch wenn sie selbst schon alte Menschen geworden sind. Als nun die Mutter der alten Frau starb, war es plötzlich sehr still im Haus. Es war so still, dass die Frau glaubte, ihre Mutter noch zu hören. Nachts vernahm sie den Wind, aber der Wind war draußen gewesen hinter den Fenstern, und sie hörte das Dach, wie es flüsterte. Manchmal schloss die alte Frau ihre Augen in der Dunkelheit und schlief ein. Es war immer dasselbe, sie hörte im Schlaf die Stimme ihrer Mutter, wie sie nach ihr rief, und ihr Atmen und wie ein Glas zu Boden stürzte und wie die Bettdecke gewendet wurde. Davon wurde sie immerzu wach, und sie hörte scharrende Geräusche von der Treppe her, und wieder den Wind. Das ging Wochen so, kaum eine Nacht konnte die alte Frau schlafen, weil sie meinte, ihre Mutter zu hören. Einmal vor wenigen Tagen, nachdem sie wieder einmal wach geworden war, verließ die alte Frau nachts ihr Bett. Sie stieg die Treppe hinab in die Küche. Wie sie das Licht anschaltete, sah sie inmitten der Küche eine kleine, junge Schildkröte sitzen. Gestern erst soll Schnee gefallen sein. — stop

depesche aus neuseeland
![]()
ulysses: 6.58 — Vielleicht liegt die Fotografie, die Rahel vor zwei Tagen im Zug kurz vor dem Flughafen mit ihrem Handy von mir machte, soeben in Neuseeland auf einem Holztisch in der Küche ihres Hauses, dunkelgrüne Weiden, Schafe vor den Fenstern. Ja, vielleicht, das ist denkbar. Sicher ist, dass diese Aufnahme tatsächlich gemacht wurde, und dass ich auf ihr vermutlich etwas unruhig wirken könnte, weil ich Rahel so viele Jahre nicht gesehen hatte, wie sie plötzlich vor mir sitzt, ein Geist sozusagen, ich glaubte, sie sei längst gestorben. Man hatte mir erzählt, ein Freund, sie sei tot, das war plausibel, so wie Rahel lebte. Von einer Sekunde zur anderen Sekunde war sie in dem Moment der Nachricht ihres Ablebens nach Jahren vollkommener Abwesenheit, wieder zu einer Anwesenden geworden, eine Tote nun mit einem Status. Jahre war sie ein Nichts gewesen, weder da noch dort, eine Leere. Und plötzlich saß sie in meiner Gegenwart im Zug und nannte mich beim Namen. Sie wunderte sich, sie fragte: Warum siehst Du mich so seltsam an? Ich antwortete, dass ich überrascht sei. Liebe Rahel, sagte ich, ich kann noch nicht glauben, Dich hier zu sehen. Ja, so sprach ich zu ihr hin, ohne mich eigentlich hören zu können. Leider war kaum Zeit für ein Gespräch gewesen, ehe Rahel aus dem Zug stürmen würde, um das Nachtflugzeug nach Singapur noch zu erreichen. In dieser Zeit, die nur Minuten dauerte, erzählte sie, dass sie damals, vor vielen Jahren, nach Neuseeland gereist und dort geblieben sei. Sie habe Europa beinahe vergessen, sie sei nur deshalb zurückgekommen, weil ihre Mutter gestorben war. Stolz erwähnte sie, dass sie zwei Töchter habe, und ich stelle mir nun vor, wie sie vielleicht in diesem Moment, da ich meinen Text notiere, jene Fotografie gemeinsam betrachten, die auf dem hölzernen Tisch der Küche in Neuseeland liegt, ausgedruckt in schwarzer und weißer Farbe, das Gesicht eines Mannes, der staunt, der im Grunde glaubt, zu träumen. Gestern war dieses Bild zu mir gekommen, durch Luft, sagen wir, Signale. Ich hörte, wie mein Telefon ein Geräusch machte, als die Fotografie vollständig eingetroffen war. Unter dem Bild war eine kleine Notiz zu finden. Rahel schrieb: Lieber Louis, ich freu mich sehr, Dich gesehen zu haben. Ich glaubte, Du wärest nicht mehr unter uns. Melde mich wieder. r. – stop



