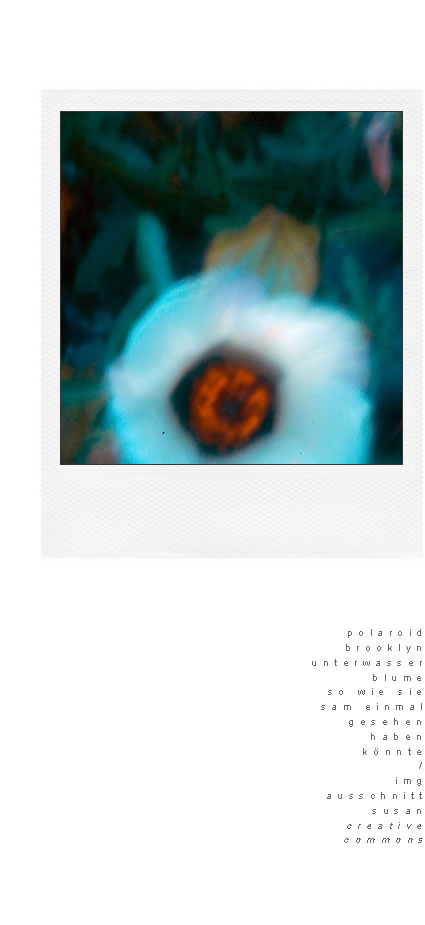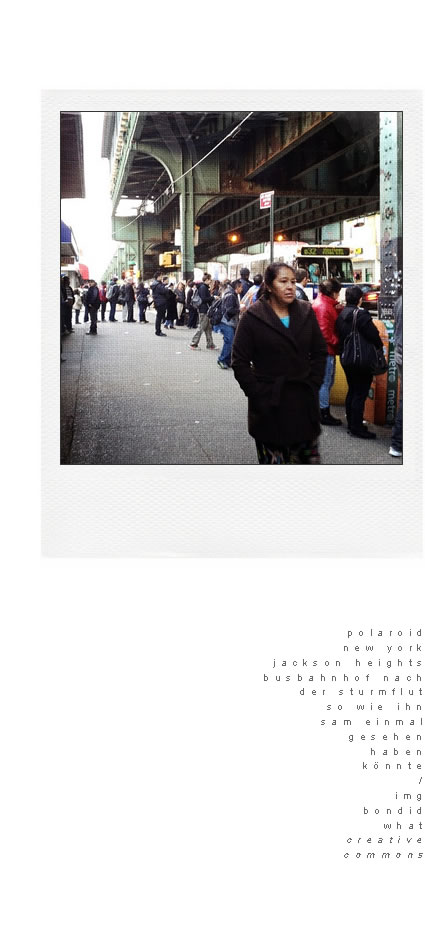tango : 22.01 — Folgendes. Immer gegen 8 Uhr in der Früh brechen wir auf, Georges und ich. Wir gehen ein paar Schritte über die Rue de Javel, nehmen die 6er-Metro durch den Süden, steigen dann um in Richtung Porte Dauphin, fahren mal unter, mal über der Erde im Kreis herum, bis es Abend oder noch später geworden ist. So kann man gut sitzen, zufrieden, durchgeschüttelt, Seite an Seite für viele Stunden, und Menschen betrachten, wie sie hereinkommen, Fahrgäste, wie sie im Waggon Platz nehmen, wie sie beschaffen sind, davon legen wir Verzeichnisse an, Georges ein Verzeichnis, und ich ein Verzeichnis. Weil es aber sehr schwer ist, ein Verzeichnis aller Erscheinungen eines Raumes anzulegen, der nicht gerade erfunden wird, eines Raumes, der sich fortbewegt, der betreten und verlassen wird von Menschen im Minutentakt, das Verzeichnis eines Raumes, dessen Fenster sich von Sekunde zu Sekunde neu bespielen, weil es also unmöglich ist, das Verzeichnis eines wirklichen Raumes anzulegen, machen wir das so: in der ersten Stunde des Reisetages notieren wir ein Verzeichnis der zugestiegenen Krawatten, in der zweiten ein Verzeichnis der Schuhe und der Strümpfe, ein Verzeichnis, sagen wir, der Gehwerkzeuge und ihrer Bekleidung, dann ein Verzeichnis der Haartrachten, der Taschen, der Methoden sich im fahrenden Zug einen sicheren Stand zu verschaffen, der Gesprächsgegenstände, der Art und Weise sich zu küssen, zu streiten, oder aber ein Verzeichnis abseitiger Gestalten, ein Verzeichnis der Diebe, der Bettler, der Posaunisten, der Verwirrten ohne Ziel, je ein Verzeichnis der Sprachen und kleiner Geschichten, die wir aus der allgemeinen Bewegung zu isolieren vermögen. Von Zeit zu Zeit, während wir so fahren und notieren, höre ich neben mir ein Lachen. Wenn Georges lacht, hört sich das an, als habe er einen Vogel verschluckt, als lache er nur deshalb, weil er Mademoiselle Moreau wieder freilassen wolle. Dann weiß ich, Georges hat etwas gefunden, das er mir abends in irgendeinem Café, wenn wir fertig, wenn Papier und Strom zu Ende sind und unser beider Köpfe so voll, dass sich nichts mehr in ihnen aufbewahren lässt, vortragen wird, – „Auf Krawatte gelb, zehnzwei, lebende Ameise, argentinisch, kreuz und quer. Der Codename Servals war Louviers“, sagt Georges und hebt sein Glas. Fünf Gläser Pastis, fünf Gläser Wasser, – dann sind wir wieder leicht geworden, und weil die Luft warm ist, weil Mai ist, nehmen wir den letzten Überlandzug nach Norden oder den 11er nach Süden, dorthin, wo die Feuernelken blühn, und wenn es endlich Morgen geworden ist, steigen wir um, öffnen die Fenster und fahren nach Westen in unserer Windmaschine spazieren. Der Regen schlägt uns ins Gesicht und wir sehen Gewitter aufsteigen und Schwefel vom Himmel kommen und weißes Licht, das die Landschaft entzündet. So haben wir schon sehr schöne Gedanken über das Feuer gefangen und über das Schlagzeug in diesem gewaltigen Raum, der über uns hängt, einem Raum, dessen zentrales Verzeichnis von nicht menschlichen Maßen ist, sodass wir bald nur schweigen und auf entfernte Menschen schauen, auf Szenen im rasenden Vorüberkommen, auf Filme, die in unseren Hin und Her hastenden Augen derart kurze Filme sind, dass sie einer Fotografie sehr nahe kommen, nicht mehr Film sind und noch nicht ganz unbewegt. Es ist ganz so, als würden wir an einer gewaltigen Aufnahme der Zeit vorüber kommen, an einer Fotografie, deren Gegenwart wir nicht berühren, weil wir nicht aussteigen können, ohne das Leben zu verlieren, weil wir zu schnell, weil wir in einer anderen Zeit sind. — stop / koffertext